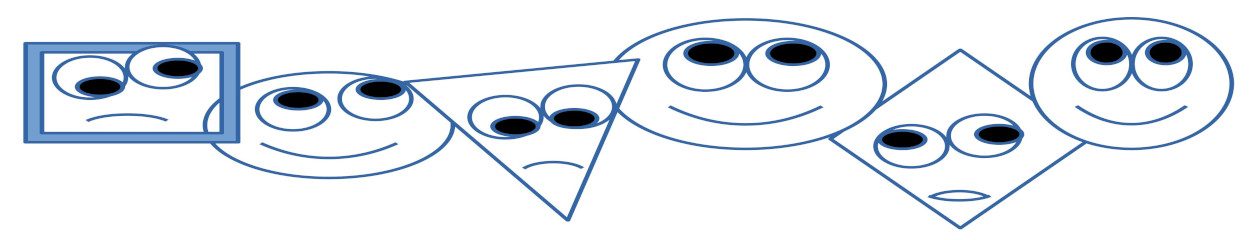Autor: Philipp Westermeier (philipp@oksimo.org)
(Letzte Änderung: 15.12.2022)
Dieser Text ist Teil des Review Bereichs von Citizen Science 2.0.
In Science and the Citizen, einem im Dezember 1957 in „Science“ und „Bulletin of Atomic Science“1 erschienenen Artikel skizziert Warren Weaver sein Verständnis vom Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, von Wissenschaftler und Bürger.
Weaver steigt ein mit einem Bild einer sich Mitte des 17. Jahrhunderts in einer londoner Taverne treffenden „Gruppe von Gentlemen“(u.a. Robert Boyle und Benjamin Franklin), die sich bei ihren wöchentlichen Treffen über die neuen Entdeckungen der Wissenschaft austauschen. In dieser Gruppe befanden sich „members of the Parliament, critics, civil servants, and pamphleteers“ die jeden Donnerstag zusammentrafen; „[they] [carried] out experiments, […] [ate] and [drank] together, but primarily they met there to discuss science“ (S. 361). Die Industrielle Revolution war noch weit entfernt, Wissenschaft war damals bloßer „intellectual luxury“, doch begründeten diese Treffen nach Weaver die Royal Society, die fast drei Jahrhunderte lang das Zentrum der westlichen Wissenschaften ausmachte.
Weaver zählt alltägliche Geräte auf, wie den Fernseher, das Auto und die elektrische Decke, um auf die weite Verbreitung von Technologien bzw. Praktiken aufmerksam zu machen, die direkt aus bzw. durch wissenschaftliche Erkenntnisse entstanden sind. Unsere Kleidung kommt bspw. Auch nicht (mehr) von den „backs of sheep, but from test tubes“ (362). Er konstatiert: „[W]hen we entered the nucleus of the atom we opened a Pandora’s box of problems of the most complex and formidable kind“ (ebd.). Daraus folgt für Weaver, dass durch diesen Prozess des ‚Fortschritts‘ Schönheit, Bereicherung und „inescapably scienfitic problems“ zusammenkommen – wie die nukleare Selbstzerstörung und die Möglichkeit des Einflusses der Menschen auf ihr Klima – wobei beides für jeden Bürger einer modernen, ‚freien‘ Demokratie gleichermaßen gelte. Daher muss auch jedem Bürger bewusst sein, dass eine Ignoranz bzw. ein Unwissen bzgl. Wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht mehr möglich ist.
Demokratie und Wissenschaft sind wohl ineinander verflochten, ob das auch für Bürger und Wissenschaftler gilt, ist nicht ganz so einfach zu klären. Was sich für die Wissenschaft ergibt ist, für Weaver, das Rekrutieren und Ausbilden von genug ‚Scientists‘ (Im deutschen Hochschulsystem wären das die MINT-Fächer) und gleichzeitig die Sichterstellung des „recruitment and training of enough good philosophers, businessmen, poets, doctors, musicologists, lawyers, theologians, etc.“, was wohl nicht zwangsläufig zusammenfallen muss.
Denn wenn wir unseren Horizont nicht erweitern, Wissenschaft nicht nur um ihrer Möglichkeiten zur Technisierung und Optimierung willens zu betrachten, sondern auch die „deeper aspects“ in den Blick nehmen; „[…] its capacity to release the mind from its ancient restraints, its ability to deepen our appreciation of the orderly beauty of nature, the essential and underlying humbleness of its position, the emphasis it places upon clarity and honesty of thinking, the richness of the partnership which it offers to the arts and to moral philosophy“(363), scheitern wir auch an der Demokratie. Er stellt die Fragen: „Who, in a democracy, really makes the decisions; and how can the decisions, in a modern scientific world, be made wisely and decently unless the public does have some real understanding of science?“(ebd.).
Für ihn ist Wissenschaft das, was Wissenschaftler machen. Wissenschaftler seien auch nur ‚ganz normale’ Menschen, durchschnittlich aber „tend to be pretty bright, and a very few of them are so exceedingly bright that they must be called geniuses“.
Denn worin die Wissenschaft gut ist, ist die Bearbeitung relativ ‚simpler‘ Probleme, physikalisch/chemischer Art. Sobald es aber um die (zu der Zeit neuen) Problemstellungen der Biologie, des Sozialen, Politische oder der Ethik geht, würden diese Beschreibungsmethoden an der erhöhten Komplexität der Phänomene scheitern.
Jedoch macht die Wissenschaft auch aus, dass immer komplexere Probleme mit immer komplexeren Problemlösungsstrategien bewältigt werden, dessen Kern das ist, was unserer Spezies den Namen Sapiens verliehen hat. Das was Wissenschaftsfähig macht, was (wissenschaftlich generierte) Fakten akzeptierbar macht, sei das zum autoritären Wissensumgang gegenläufige, also logische Präzision, persönliche Ehrlichkeit, offene Haltung, Fokus und Liebe zur Wahrheit (vgl. 363-365).
Weil das so ist, müssen Wissenschaftler immer wieder als normal gedacht werden, was laut Weaver nicht gegeben sei. Er attestiert „an uncomfrotable relation to science“, die vor und nach der der Wissenschaft auch immer anhaftenden Technisierung entsteht.
Die große Herausforderung, die Weaver am Ende an seine Leserschaft adressiert, ist der Fakt, dass der Bürger die Wissenschaft fürchtet, wo er sie verstehen sollte und dass die Wissenschaft nicht richtig über ihr tun aufklärt, obwohl das, Sir Edward V. Appleton zitierend zu ihrem gesellschaftlichen Auftrag gehört. Zwar gibt es diese Aufklärungen, Oppenheimer zitierend, über die Unvollständigkeit theoretischer Konstruktionen, jedoch auf der anderen Seite diesen Aberglauben in der Bevölkerung, die Wissenschaft könne alle Probleme lösen.
Struktur, Methode und Akteure der Wissenschaft
Weavers Wissenschaftsverständnis kann als Zwei-Ebenen-Prozessmodell verstanden werden. Die entwicklungsgeschichtliche, langfristige Prozessebene beginnt um den 15. Juli 1662, als der Royal Society Club den damaligen Forschungsstand wöchentlich in einer Taverne bespricht. Die Ebene der wissenschaftlichen Praxis – „analyzing nature“(S. 363) – besteht aus einem kleinteiligen, iterativen Prozess, „of designing experiments to lear the facts, of formulating general rules for describing nature’s uniformities, of dreaming up possible new and even more general rules, and then testing by experiment to see if the rules are valid“(ebd.).
Dialektisch kann beides in der Zusammenschau begriffen werden, „[s]tep by step and accumulatively“ (S. 363), „[o]ne stubborn and complicated problem after another has given way before the evolving techniques of science“ (S. 364).
Die WissenschaftlerInnen, welche diesen Prozess vorantreiben, sind nach Weaver vielleicht etwas „heller“, etwas interessierter an der Welt an sich und an der Lösung von Problemen die durch ihre jeweiligen Beschreibungsapparate, mit denen sie versuchen die Welt zu verstehen, entstehen. Jedoch sei der einzig große Unterschied zwischen ihnen und den „durchschnittlichen BürgerInnen“ der einer „intellectual inheritance, transmitted to them in their education as scientists, from the centuries of tradition about the scientific method and the scientific attitude toward the world“ (ebd.).
Ein Problem zwischen WissenschaftlerIn und BürgerIn besteht eben nur deshalb, weil BürgerIn „tends to fear science; when [s]he should learn about it“ (S. 365), und WissenschaftlerIn nach Sir Edward V. Appleton ihre „Mission“ nicht annehmen würde, dafür bereit zu sein, „to leave his[/her] laboratory to act as a guide“ (vgl. ebd.).
Der wissenschaftliche Prozess hat daher Erfolg, da er es schafft, einen dem Menschen eigenen Prozess der Einsicht so zu professionalisieren, dass extrem einfache Gesetze herausgearbeitet werden können, die in ihrer Zusammensetzung dann ein enormes Erklärungs- und Anwendungspotenzial aufweisen (vgl. 363-364). Diese Gesetze bauen aufeinander auf, das Komplexe baut auf dem Einfachen auf. Die moderne Physik legt den Grundstein der modernen Chemie, diese legt den Grundstein der modernen Biologie, welche wiederum den Grundstein der modernen Psychologie und Ökonomie legt. Jedoch nicht wie eine Pyramide. Es wird bei zunehmender Komplexität der Phänomene auch der Prozess komplizierter und langwieriger. Dort wo der Reduktionismus mehr oder weniger funktioniert, in der Physik oder der Chemie kommt man in der Biologie oder Verhaltensforschung nicht mehr weiter. Es stellen sich neue Herausforderungen wie Beobachtungsverfahren für Phänomene, die aus der Gleichzeitigkeit von Komplexität entstehen.
Reflexion
+++ In Bearbeitung +++
Kommentare
1 Warren Weaver, Science and the Citizens, Bulletion of the Atomic Scientists, 1957, Vol 13, pp. 361-365.