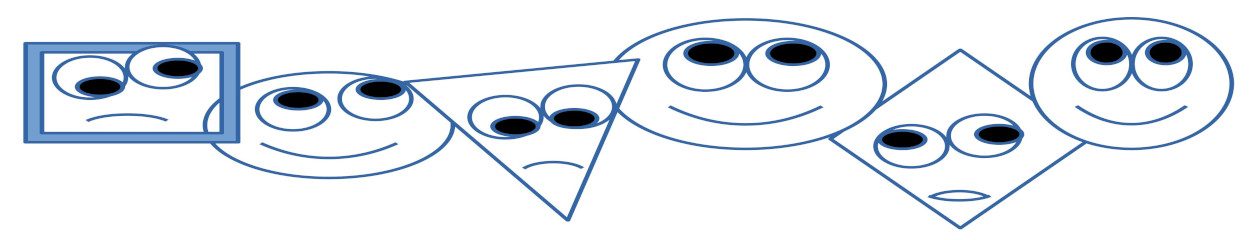UNIVERSELLE PROZESSPLANUNG
2.Okt 2021 – 14.Okt 2021
URL: oksimo.org
Email: info@oksimo.org
Autor: Gerd Doeben-Henisch (gerd@oksimo.org)
KONTEXT
Dieser Text ist Teil des Themenknotens DEMOKRATIE innerhalb des BEGRIFFLICHEN RAHMENS ZUM OKSIMO PARADIGMA innerhalb des oksimo.org Blogs.
MENTALER VIRUS
Der Begriff des ‚Virus‘ ist uns im Jahr 2021 mindestens zweifach vertraut: einmal (i) die biologische Variante von speziellen Zellen, die andere Zellen ‚kapern‘ und ‚umprogrammieren‘ können, und (ii) die Computervariante, dass ein spezielles Computerprogramm in ein anderes Computerprogramm eindringen und die Kontrolle über dieses andere Programm bekommen kann. Obwohl Viren aufs Ganze gesehen nicht nur schädlich sind, sondern letztlich sogar zur Weiterentwicklung von Zellen oder Programmen beitragen können, können sie akut und im Einzelfall zu schweren Schäden beitragen.
Wie soll man dann das Konzept eines ‚mentalen Virus‘ verstehen?
Meme
Seit der Veröffentlichung von Richard Dawkins [2a] höchst einflussreichem Buch (1976) „The Selfish Gene“ [2b] gibt es den Begriff ‚meme‘ (Engl.), um den Gedanken der genetisch erklärten Reproduktion irgendwie auf den Bereich des Kognitiven, des Mentalen, ja auf die ganze Kultur zu übertragen. Im Deutschen Wikipedia-Artikel [1] kann man beobachten, dass das Bedeutungsfeld zur Wortmarke ‚Meme‘ seit dem Erscheinen des Buches von Dawkins 1976 so stark zerfasert ist, dass es mittlerweile ‚alles und nichts‘ bedeutet.
Von daher liegt es nahe, sich von diesem unübersichtlichen Wortfeld abzugrenzen und hier versuchsweise eine Bedeutung des Konzepts ‚Mentaler Virus‘ zu geben, der in diesem Text benutzt werden soll.
Mentales
Im Rahmen der Gedankenwelt zur oksimo Theorie [3] werden unter anderem bestimmte Annahmen über die menschlichen Akteure gemacht, welche Eigenschaften man für sie postulieren muss, damit sie in der Weise miteinander sprachliche kommunizieren und koordiniert handeln können, wie wir es alltäglich beobachten können.
Als eine wesentliche Eigenschaft wird in der oksimo Theorie angenommen, dass das menschliche Gehirn im Körper des Menschen in der Lage ist, die vielfältigen sensorischen Signale aus der Umwelt und aus dem Körper (und ‚von sich selbst‘) zu neuronalen Strukturen zu organisieren, in denen wesentliche Eigenschaften der Umwelt, des Körpers und ‚des eigenen Operierens‘ stark vereinfacht repräsentiert werden können. Die Gesamtheit dieser Repräsentationen und Operationen werden als ‚Kognition‘ bezeichnet oder auch als ‚mentaler Raum‘ (kurz: das ‚Mentale‘). Diese Repräsentationen und Prozesse sind geschätzt zu 99% oder mehr ’nicht bewusst‘.
Zeichensysteme
Ein interessanter Teilaspekt des Mentalen sind interne Zeichensysteme, die in großer Flexibilität in große Teile des Mentalen (einschließlich der Zeichensysteme selbst) ‚abgebildet‘ werden können. Insofern die internen Zeichensysteme über externe Zeichensysteme (Laute, Schriftzeichen, Gesten, …) über komplexe Transformationen in der Umwelt als Umweltereignisse auftreten können, besteht hier eine rudimentäre Möglichkeit für Gehirne, ihre ‚inneren (mentalen) Zustände‘ mit anderen Gehirnen — nicht 1:1 — ‚auszutauschen‘.
Mentale Bilder
Die durch die Zeichensysteme abbildbaren internen mentalen Aspekte eines Gehirns können bei anderen Gehirnen Umrisse von Repräsentationen manifestieren, die Aspekte sowohl der gemeinsamen Umwelt wie auch Aspekte einer individuellen ‚Innenwelt‘ repräsentieren, die beschreibende Kraft entfalten können: sprachliche Kommunikation kann ‚mentale Bilder‚ transportieren, die ein wenig erkennen lassen, wie das sendende Gehirn seine Umwelt und sich selbst ‚repräsentiert‘ und darin die Dinge ’sieht‘.
Wirklichkeitsbezug
‚Mentale Bilder‘ können auf die ‚Empfänger-Gehirne‘ wie auch auf das ‚Sendende Gehirn selbst‘ Wirkungen entfalten, die die weiteren mentalen Operationen wie auch ein daraus resultierendes äußerliches Verhalten beeinflussen. Die durch sprachliche Kommunikation vermittelten ‚mentalen Bilder‘ kann man grob danach klassifizieren, ob sie mit den empirischen Umständen einer Umwelt ‚korrelieren‘ (das nennt man gewöhnlich ‚wahr sein‘) oder ’nicht korrelieren‘. ‚Nicht korrelieren‘ heißt per se nicht unbedingt ‚falsch sein‘. Bei nicht korrelierenden mentalen Bildern ist der Wirklichkeitsbezug zunächst nur ‚unbestimmt‘. Bei typischen ‚Voraussagen‘ gehört es ja zur ‚Rolle‘ der Kommunikation, ein Bild zu kommunizieren, von dem man sagt, dass dieses Bild unter bestimmten Bedingungen C mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit P eintreten kann. Würde ein bestimmtes empirisches Ereignis E eintreten, von dem alle Beteiligten sagen würden, dass es eine ‚Instanz des vorhergesagten Bildes B‘ ist, dann würde man dann sagen, dass sich die Voraussage von B durch E ‚erfüllt‘ hat, die Voraussage also als ‚wahr‘ unter diesen Bedingungen C bezeichnet würde. Würde ein solches Ereignis E nie eintreten, dann bliebe der empirische Bezug der Aussage B weiter unbestimmt.
Wollte man explizit eine ‚falsche Aussage‘ erzeugen, dann müssten jemand eine Aussage B äußern, deren Bedeutungsgehalt aus einem mentalen Bild E* besteht, das von allen Beteiligten in mehreren vorausgehenden Situationen anhand eines empirischen Sachverhalts E ‚validiert‘ worden ist. Wenn jetzt jemand die Aussage B mit dem validierten Bedeutungsgehalt E* macht, dann würden alle Beteiligten erwarten, dass in der gemeinsam geteilten Situation ein empirischer Sachverhalt E gegeben ist, der als ‚Instanz‘ die Aussage B ‚erfüllt‘. Wäre dies nicht der Fall, gäbe es also keinen empirischen Sachverhalt E, dann würden alle Beteiligten sagen, dass die Äußerung der Aussage B nicht zutrifft. Also: B wird behauptet und alle sind sich einig, dass B nicht zutrifft, also Nicht-B zutrifft.
Wie die alltägliche Praxis von sprachlicher Kommunikation zeigt, ist die Klassifikation einer sprachlichen Aussage als ‚falsch‘ alles andere als einfach, genauso wie der Aufweis der ‚empirischen Richtigkeit‘ einer Aussage sehr schnell sehr schwierig werden kann. Wir wandeln also alltäglich auf einem schmalen Grad von verstehbarer und akzeptierter ‚Wahrheit‘ bzw. ‚Falschheit‘
Mentaler Virus
Biologische wie auch Computer-Viren sind ja per se ’nicht Nichts‘; biologische Viren sind zellähnliche Gebilde, die sich an reale Zellen andocken können und die das Innere der anderen Zelle, ihr ‚genetisches Programm‘, so transformieren können, dass es nach der Transformation ein anderes Verhalten zeigt als vorher. Entsprechend beim Computer-Virus.
Insofern wir Menschen mittels sprachlicher Kommunikation ‚mentale Bilder‘ übermitteln können, die als solche eine Wirkung auf das empfangende Gehirn ausüben können, können solche übermittelten mentalen Bilder wie ‚mentale Viren‘ wirken: sie können dazu führen, dass das empfangende Gehirn seine bisherige mentale ‚Bilderwelt‘ durch Einbau der neuen empfangenen Bildern ‚umbaut‘. Fast kann man sagen, dass jedes ‚mentale Bild‘ ein ‚potentieller mentaler Virus‘ ist, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das empfangende Gehirn seine bisherige Bilderwelt ‚verändert‘.
Ein Mensch, der bislang davon ausgegangen ist, dass eine bestimmte Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf mit Virus X schützen kann, kann durch ein mentales Bild seine Meinung dahingehend ändern, dass die Impfung nicht schützt oder gar schadet. Umgekehrt kann jemand, der bislang nicht an die Wirkung einer Impfung geglaubt hat, plötzlich die Voraussage eines möglichen Schutzes akzeptiert. Der lückenlose Aufweis der empirischen ‚Richtigkeit‘ des einen wie des anderen mentalen Bildes ist im Einzelfall nur sehr mühsam über viele verschiedene mentalen Bilder ‚erklärbar‘, die auf komplexe Weise aufeinander verweisen. Aber selbst wenn es überwältigend viele ’statistische Daten‘ zur ’schützenden Wirkung‘ eines Virus gibt, muss dies für den Anhänger des anderen mentalen Bildes nichts bedeuten: man kann immer Gründe finden, diese Daten in Frage zu stellen. In unserer komplexen stark arbeitsteiligen Welt sind wir fast immer darauf angewiesen, der Arbeit und den Ergebnissen zu vertrauen, die von anderen Menschen erbracht wurden. Wir können schlicht nicht alles selbst überprüfen, was uns betrifft. Wenn also jemand sein ‚Fundamentalvertrauen‘ in seine Umwelt auf Null stellt, dann kann es keine empirischen Ereignisse mehr geben, die das eigene mentale Bild in Frage stellen; umgekehrt ist es in allen komplexen Fällen aber auch nicht leicht möglich, sein eigenes mentales Bild als ‚wahr‘ zu erweisen, zu ‚verifizieren‘. [6a], [6b]
Kulturelles Locked-In Syndrom [4]
Wenn einzelne Mitglieder einer Gesellschaft in die Situation kommen, dass ihr Fundamentalvertrauen in ihre Umwelt gegen Null geht, dann ist dies sehr schnell sehr gefährlich, lebensbedrohlich, und mit dem betreffenden Menschen kann alles passieren: Verzweiflung, Depression, Wahnvorstellungen, Hass, Selbstmord oder Attentate auf andere.
Wenn der Prozentsatz von Menschen in einer Gesellschaft zunimmt, bei denen das Fundamentalvertrauen gegen Null geht, dann kann eine ganze Gesellschaft zunehmend gestört werden. Selbst normale Abläufe im Alltag können dann in Stottern geraten und können damit das elementare Miteinander real gefährden.
Eigentlich repräsentieren das menschliche Gehirn und die sprachliche Kommunikation die größte Errungenschaft, die die biologische Evolution in den letzten ca. 3.5 Milliarden Jahren ermöglicht hat; wenn aber das wechselseitige Fundamentalvertrauen fehlt, dann läuft dieser Mechanismus ins Leere; dann schließt sich jeder in seine eigene Welt mentaler Bilder ein, fühlt sich darin großartig, aber alle wichtigen Kooperationen, die zum Erhalt und zum Fortbestand oder gar zur Weiterentwicklung menschlicher Gesellschaften notwendig sind, finden einfach nicht mehr statt: jeder ‚für sich‘ ist der Größte, aber alle zusammen tendieren gegen Null.[7]
Dies ist auch ein Hinweis auf die allem Leben (und letztlich aller Materie) eingebaute ‚Freiheit‘: wir können immer das eine tun, wir haben aber die Freiheit, es auch nicht zu tun, und sei es noch so unsinnig. Und da die Abstimmung zwischen Menschen durch mehr kommunikativ vermittelte Kooperationen mehr Anstrengung verlangt, als einfach alles in Frage zu stellen, ist die Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen konstruktiven Prozesses immer geringer als die Wahrscheinlichkeit, zu gemeinsamem konstruktiven Verhalten zu finden.[8]
(LIBERALE) DEMOKRATIE
Das, was bislang vielleicht so abstrakt klingt, hat unmittelbare quantifizierbare empirische Auswirkungen. Wie das schwedische V-dem Forschungsinstitut berichtet (vgl. [5a] – [5e]), gab es 2010 noch 32 Staaten von 208, auf die ihre Definition von ‚liberaler Demokratie‘ zutraf. 2020 waren es nur noch 16. Dies bedeutet, der Anteil liberaler Demokratien, der im Jahr 2010 noch mit 15,4% beziffert wird, halbierte sich innerhalb von 10 Jahren auf 7.7%. Auch wenn diese Zahlen sehr grob und die beteiligten Prozesse äußerst komplex sind, ist die Tatsache, dass 2020 nur 7.7% der Staaten als liberale Demokratien klassifiziert werden können, letztlich ein empirischer Indikator, wenn auch grob. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von 208 Staaten eine liberale Demokratie ist, liegt im Jahr 2020 bei diesen Zahlen bei 16/208 = 0.0769 (im Gegensatz zu 0.15 im Jahr 2010).[11]
Dieser dramatische Rückgang um 50% innerhalb von nur 10 Jahren lässt aufmerken. Es wäre interessant zu schauen, welche empirische Indikatoren aus den V-dem Erfassungsdaten sich wie geändert haben, dass es zu dieser Verschlechterung gekommen ist. Noch besser, man könnte herausfinden, welches die ‚wichtigsten‘ Faktoren sind, die zu solch einer Verschlechterung beigetragen haben.
Vor diesem Hintergrund ist es sehr erstaunlich, dass in den Staaten, die noch als liberale Demokratien gelten, der Diskurs zu den Notwendigkeiten einer ’nachhaltigen Demokratie‘ nirgendwo ernsthaft etabliert ist. Im Rahmen von Bildung und Forschung ernsthaft über Demokratie zu diskutieren und dazu experimentell zu arbeiten, gilt tendenziell eher als ‚uncool’…
OKSIMO und MENTALE VIREN
Angenommen, die soeben skizzierten Thesen stimmen, dann stellt sich die Frage, ob und wie der Einsatz der oksimo Software mit ihrem spezifischen oksimo Handlungsraum dazu beitragen könnte, (i) bestehende Grenzen zwischen verschiedenen Bilderwelten zu verflüssigen und/ oder (ii) die Entwicklung von solchen gemeinsamen Bilderwelten zu begünstigen, deren Wirklichkeitsbezug ‚größer‘ ist.
Da der wesentliche Grund für die Entstehung und Existenz unterschiedlicher Bilderwelten darin besteht, dass es keinen absoluten Bezugspunkt gibt, der automatisch (und freiwillig) von allen Menschen akzeptiert wird, liegt der entscheidende Gestaltungsfaktor für das Zustandekommen einer Bilderwelt im einzelnen Akteur. Sachverhaltswissen ist das eine; emotionale Konnotationen das andere. Diese 2-Faktoren Struktur kann sich dahingehend auswirken, dass bestimmte emotionale ‚Voreinstellungen/ Interessen/ Traumata/ … den Umgang mit mentalen Bildern in einer Weise beeinflussen, dass zwischen verschiedenen Menschen in der gleichen Situation völlig unterschiedliche Verhaltensweisen zustande kommen können. Will man also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Gruppe von — idealerweise zufällig zusammengewürfelten — Menschen zur Entwicklung einer gemeinsamen Bilderwelt kommt, dann müssen alle Bilder ‚auf den Tisch‘ kommen können, die die einzelnen Beteiligten für wichtig finden (Ausgangslage). Die Gruppe muss sich auch auf eine Zielformulierung einigen können: welche Zielzustände möchte man anzielen. Auch hier müssen prinzipiell alle Ziele erlaubt sein. Und dann benötigt man einen Prozess, der versucht, die Zielzustände anzunähern durch Angabe konkreter Maßnahmen, durch die dies geschehen. Auch hier sind alle Maßnahmen erlaubt. Über Simulationen, gemeinsames Spielen und weiterer Optionen von oksimo kann man diese Bilderwelt weiter ‚von verschiedenen Seiten anschauen‘.
Dieses Verfahren beruht auf einer radikalen Akzeptanz aller Sichten, die es möglich macht, die Vielheit und Unterschiede überhaupt erst mal sichtbar zu machen, die zwischen Menschen besteht. Ferner wird das Maximum an Wissen sichtbar, über das die beteiligten Akteure verfügen. Diese Unterschiede gründen in den unterschiedlichen individuellen Lerngeschichten, innerhalb deren unterschiedliche Emotionen eine selektive Rolle gespielt haben und dann auch in der aktuellen Situation spielen. Durch die Sichtbarmachung des verfügbaren Wissens werden indirekt auch alle aktiven Emotionen in Gestalt von Präferenzen sichtbar. Durch die unmittelbare soziale Nähe der Beteiligten besteht eine gewisse Chance, sich über die Unterschiede und Präferenzen auszutauschen. [9]
Diese methodische Situation eines oksimo Prozesses wirkt auf den ersten Blick vielleicht ’schwach‘, aber die Wellen an Aufregungen, Missverständnissen oder gar dann Hass, die durch ein de-personalisiertes Netz jeden Tag rollen, zeigt, dass die Entkopplung von Bilderwelten und sozialer Beziehung insgesamt ungut ist. Soziale Nahbereiche bleiben die Wurzeln unseres sozialen Zusammenlebens.
Die oksimo Handlungsräume sind sicher kein Allheilmittel, aber sie eröffnen durch ihre radikale Transparenz, durch ihre Differenziertheit bzgl. Prozesse und Wechselwirkungen und durch ihre potentiell größere soziale Nähe ein klein wenig mehr die Möglichkeit, Keimzellen für liberal demokratische Verhaltensweisen zu werden.[10]
ANMERKUNGEN
[1] Wort ‚Meme‘ in Wikidpeia DE: https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen)
[2a] Richard Dawkins in Wikipedia EN: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins. Führte in seinem Buch (1976) ‚The Selfish Gene‘ u.a. den Begriff ‚Meme‘ ein.
[2b] Dawkins, Richard (1976). The Selfish Gene (2nd ed.). United Kingdom: Oxford University Press. ISBN978-0-19-286092-7. /* Eine einführende Diskussion des Buches findet sich hier: Wkipedia EN: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene
[3] Von einer ‚oksimo Theorie‘ im strengen wissenschaftsphilosophischen Sinne zu sprechen, ist aktuell vielleicht noch nicht ganz korrekt, da die vielen Beiträge in den einschlägigen Blogs uffmm.org sowie oksimo.org zwar einen harten Kern von Konzepten erkennen lassen, aber diese sind noch nicht in eine völlig ausgearbeitete Theorie integriert. Die Prozesse laufen aber und das Ergebnis ist im Prinzip schon absehbar.
[4] Der Begriff ‚locked-in syndrom‘ ist primär ein medizinischer Begriff (siehe: Wikidepia EN: https://en.wikipedia.org/wiki/Locked-in_syndrome), der die Abgeschlossenheit des Gehirns von wichtigen Kommunikationskanälen meint. Im Text wird locked-in leicht anders interpretiert, hier als die ‚Abgeschlossenheit des Mentalen eines Individuums‘ von den gesellschaftlich akzeptierten Verfahren einer Wahrheitsfeststellung.
[5a] V-dem Webseite: https://www.v-dem.net/en/
[5b] Berichtsseite: https://www.v-dem.net/en/publications/democracy-reports/
[5c] Interaktive grafische Seiten: https://www.v-dem.net/en/online-graphing/
[5d] Beispiel ‚Egalitarina Democracy‘: https://www.v-dem.net/en/news/egalitarian-democracy/
[5e] Video von einer Konferenz zum Thema ‚Egalitarian Democracy‘: https://www.youtube.com/watch?v=ARBBiMgJT7A
[6a] Ein anschauliches Beispiel zu diesem ‚Balanceakt‘ zwischen ‚Aussage als wahr akzeptieren‘ und ‚Aussage als falsch qualifizieren‘ mit Blick auf die ‚Umstände einer Äußerung‘ ist der Artikel „Mitglieder der „Pathologie-Konferenz“ verbreiten unbelegte Behauptungen über Covid-19-Impfungen und Todesfälle“ vom Recherchenetzwerk correctiv.org (siehe: https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/25/mitglieder-der-pathologiekonferenz-verbreiten-unbelegte-behauptungen-ueber-covid-19-impfungen-und-todesfaelle/ ) ein gutes Beispiel. Über ein Video verbreiten zwei Personen ein bestimmtes Bild zur Verunreinigung und zur schädlichen Wirkung von Corona-Impfungen am Beispiel der Obduktion von Organen von 10 toten Menschen. Soll man dies glauben? Im Artikel des Recherchenetzwerks correctiv wird die Glaubwürdigkeit dieses Videos auf vielfache Weise in Frage gestellt. Soll man jetzt der Argumentation des Artikels glauben? Es wäre interessant, einen empirischen Test zu machen und n Personen zu fragen, die das Video überzeugend finden, ob sie nach Lesen des Artikels von correctiv ihre Meinung ändern würden. Eine Arbeitshypothese wäre die, dass von 100 Personen, die sich vom Video überzeugen lassen, vielleicht 7-10 ihre Meinung nach Lesen des Artikels ändern würden. Dies wäre ein empirisches Indiz dafür, wie stark die Kohäsionskraft (das Beharrungsvermögen) einer bestehende eigenen Meinung ist.
[6b] Ein weiteres Beispiel ist die Existenz und die Resonanz des ‚Corona-Ausschusses‘ (siehe Bericht im Berliner Tagesspiegel vom 2.Oktober 2021: https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/luegen-und-hetze-im-berliner-corona-ausschuss-im-impfstoff-ist-so-etwas-wie-lebendige-kraken/27670234.html ). Für die einen — wie z.B. auch für den Autor dieses Textes — sind die Inhalte des Corona-Ausschusses weitgehend absurd; für andere ist es die angemessene Sicht ihrer Welt. Während man nun versuchen kann, die einzelnen ‚Fakten‘ im einzelnen mit überprüfbaren Realitäten zu begründen oder zu belegen, ist der philosophisch interessante Aspekt genau der, warum es überhaupt zu solch entgegen gesetzten Positionen im Denken von Menschen kommen kann? Die Wurzel dieser Verschiedenheit liegt dort, wo das, was die eine Gruppe als ‚Fakten‘ anerkennt, von der anderen Gruppe bestritten wird, und umgekehrt. Es geht also gar nicht in erster Linie um ‚Fakten‘, sondern es geht um ‚Meinungen‘, die in den Gehirnen der Beteiligten ‚aktiv‘ sind, von denen sie nicht abrücken wollen, egal, welche Fakten aufweisbar sind. … genau das Thema dieses Posts.
[7] Die Reduzierung des Fundamentalvertrauens in ‚die Gesellschaft‘ schließt nicht aus, dass jemand konkrete Personen in seinem Umfeld kennt, denen er/sie trotzdem vertraut, sofern sie ähnliche Einschätzungen haben wie man selbst. Sofern es viele einzelne oder kleine Gruppen gibt, die ‚gemeinsame Bilder teilen‘, kann das Nullvertrauen in die ganze Gesellschaft sich über dieses ‚partielle Vertrauen‘ in eine Gruppierung ‚der Bilderwelt X‘ (z.B. ‚gegen Corona Impfung‘, ‚gegen Masken‘, …) dennoch numerisch verstärken.
[8] Unter Berücksichtigung von [7] kann diese alternative Bilderwelt zu einer ‚gesellschaftlichen Mehrheit‘ anwachsen. Diese ’numerische Mehrheit‘ zeigt sich aber im Umgang mit den Bildern von der Welt — folgt als Arbeitshypothese aus der Theorie — wesentlich rigider und dogmatischer als die ursprüngliche Gesellschaft einer angenommenen liberalen Demokratie.
[9] Offene Frage: in welchem Umfang und wie kann man eine ‚minimale Vertrauensatmosphäre‘ ermöglichen, dass Unterschiede überhaupt erst mal ‚ertragen‘ werden?
[10] Ein interessanter Aspekt des ganzen Themas ist auch, dass eine Vielfalt, die wechselseitig um eine ‚Deutungshoheit‘ ringt, tatsächlich nur in demokratischen Gesellschaften existieren kann, die hinreichend liberal sind. In allen anderen Staaten (man probiere dies mal in Ländern wie Russland, China, Türkei, Iran, Afghanistan, …) mit unterschiedlich starken autoritären und nicht-liberalen Strukturen werden abweichende Meinung sofort massiv sanktioniert. Aber selbst demokratische Gesellschaften können in ‚Stresssituationen‘ kommen, wenn bestimmte Meinungen ein Gefährdungspotential für andere sehen, die Träger der anderen Meinungen dieses Gefährdungspotential aber abstreiten. Ein kaum sauber auflösbarer Konflikt. Es geht hier primär nicht mehr um ‚Wissen‘, sondern um ‚Glauben‘. Viele Jahrtausende haben gezeigt, wie aus ‚Glauben‘ tödliche und blutige Kriege folgen konnten, denn ‚Glauben‘ definiert einen ‚Wahrheitsanspruch‘, der sich nicht für alle transparent klären lässt. Seit ca. 500 Jahren wurde entdeckt, wie man ‚überprüfbares Wissen‘ ‚gewinnen‘ kann; man nennt dies ‚Wissenschaft‘. Aber, was nützt es, unter großem gesellschaftlichen Aufwand, Wissenschaft zu betreiben, wenn eine wachsende Gruppe von Bürgern weder versteht, wie Wissenschaft funktioniert, noch bereit ist, Wissenschaftlern zu glauben? Dann bleibt nur noch ‚Glauben‘, der mit ‚beliebigen Fakten‘ agiert. …. aber selbst dafür gibt es in den heutigen Demokratien die ‚Religionsfreiheit‘: man darf Beliebiges glauben (auch wissenschaftlichen ‚Unsinn‘); die Demokratie schützt dies. Ist dies schlecht? Im Lichte der Evolution des Lebens auf dem Planet Erde muss man konstatieren: in einer Gegenwart vor dem homo sapiens war es niemals möglich, zweifelsfrei zu erkennen, welche der aktuellen Lebensformen mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft tatsächlich überleben würden. Frage: haben wir heute als Homo-Sapiens Lebensform bessere Möglichkeiten, das ‚Wichtige‘ vom ‚Unwichtigen‘ zu unterscheiden?
[11] In einem email-Gedankenaustausch mit Mirko de Paoli ging es um die Frage, wie man diesen ‚Mehraufwand‘ für Demokratien verstehen soll. Der Gedanke, der dem Text im Blog zugrunde liegt, ist der, dass (i) das bloße Wiederholen einer bestehenden Meinung ‚einfacher‘ ist als (ii) die gemeinsame Erarbeitung einer Meinung von ihren ‚Bestandteilen‘ her. Variante (ii) erfordert viel kommunikativen Aufwand, Zeit, emotionale Energie, und möglicherweise mehr. ‚Intuitiv‘ erscheint diese Überlegung richtig. Wie aber kann man sie empirische überprüfen, d.h. mit einem empirischen Messvorgang verknüpfen? Nimmt man die Ergebnisse des V-dem Instituts (siehe [5a]) ernst, dann wirken diese Ergebnisse in Zahlen sehr abstrakt, aber es sind Zahlen: 2010 noch 32 Länder als ‚liberale Demokratien‘; 2020 nur noch 16. Ein Rückgang von 32 auf 16 in nur 10 Jahren. Den Anteil von ca. 7.7% liberale Demokratien kann man versuchsweise auch für eine Wahrscheinlichkeitsüberlegung benutzen, dass von 208 Staaten im Jahr 2020 liberal demokratische Staaten nur mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0.07 vorkommen und nicht-liberale Demokratien mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0.92. Das Verhältnis beider Wahrscheinlichkeiten zueinander ist 12:1. Dies kann man so interpretieren (Arbeitshypothese), dass 12x mehr Aufwand notwendig ist, eine liberale Demokratie zu realisieren als eine nicht-liberale Demokratie. Dies führt dann sofort zu der Frage, ob man empirisch verifizierbare Faktoren identifizieren kann, deren Vorhandensein und deren Beschaffenheit für eine liberale Demokratie wichtig sind. Hinweise dazu finden sich in der langen Liste an Eigenschaften, die die ca. 3500 Experten des V-dem Instituts in den Ländern des Planeten Erde seit Jahren ‚beobachten‘. Interessant wäre es dann, zu klären, in welchem Sinne diese Faktoren für eine funktionierende liberale Demokratie wichtig sind; vermutlich sind sie ‚unterschiedlich wichtig‘, d.h. sie sollten in der Gesamtbetrachtung eine unterschiedliche ‚Gewichtung‘ bekommen. Ein solcher Faktor ist das Bildungssystem: wie wichtig ist es? Auf welche Eigenschaften eines Bildungssystems kommt es an? Die aktuell nahezu ’sinnentleerte‘ Diskussion zur notwendigen Digitalisierung der Schulen in Deutschland zeigt, dass wir mit einer Klärung der Rolle von Bildung noch nicht allzu weit voran gekommen sind.
MEDIA
Nachgereicht: 14.Okt.2021: Ein einfacher Soundtrack, dessen Text versucht, die Grundidee des Artikels — siehe auch Anmerkung [11] — in einfache Worte zu fassen. (Aufnahmemethode: RUM := Radically Unplugged Music)
Ein älterer Versuch, mehr abstrakt: