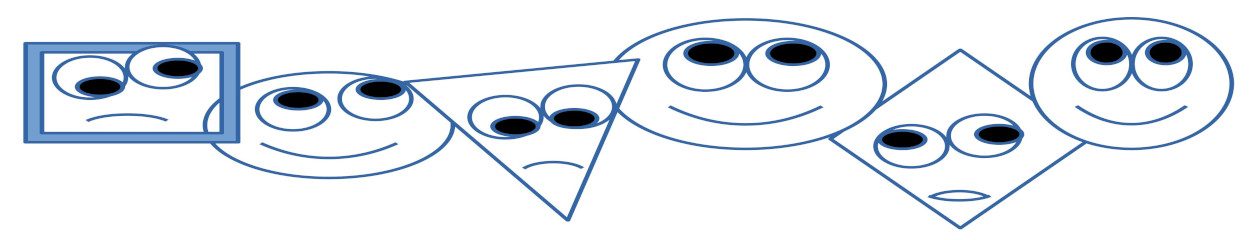UNIVERSELLE PROZESSPLANUNG
2.Juli 2021 – 3.Juli 2021
URL: oksimo.org
Email: info@oksimo.org
Autor: Gerd Doeben-Henisch (gerd@oksimo.org)
KONTEXT
Dieser Text ist ein Diskussionsbeitrag zum Artikel DAS OKSIMO PARADIGMA UND KOMMUNEN – Bürgerbeteiligung und Politische Parteien des Themenbereichs UNIVERSELLE PROZESSE PLANEN – Aus Sicht der Kommunen im oksimo.org Blog.
Anmerkung zu „DAS PRINZIP DER REPRÄSENTATION“
Kontext zum Artikel
Wie im vorausgehenden Artikel zu Bürgerbeteiligung und politische Parteien hervorgehoben wurde, muss das formale Prinzip der Gründung von Parteien, über die gewählte Repräsentanten bereit gestellt werden, um in verfassten Gremien die Regeln für ein gemeinsames Leben zu entscheiden, unabdingbar ergänzt werden um jene Kompetenzen, die notwendig sind, um die anstehenden Fragen sachlich angemessen erkennen und beantworten zu können.
Im Grundgesetz und im Parteiengesetz werden keinerlei Hinweise geliefert, wie die Einbeziehung notwendiger Kompetenzen real vonstatten gehen soll. Das formale Element der periodischen Wahlen ist als solches keinerlei Beitrag zur Frage von wirksam geteilten Kompetenzen. Im Parteiengesetz findet sich zwar der unübersehbare Hinweis, dass mit der Bereitstellung von Kandidaten für eine Wahl allein der Auftrag einer politischen Partei nicht vollstän dig erfüllt wird, aber konkrete Hinweise, wie eine kontinuierliche und nachhaltige Einbeziehung von Bürgern und ihrer Kompetenzen über das bloße Wählen von Repräsentanten hinaus aussehen sollte, findet sich nicht.
In diesem Zusammenhang ist interessant, was der amtierende Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, dazu in der FAZ vom 1.Juli 2021 in der Nr.149, S.6, schreibt.
ARTIKEL SCHÄUBLE
(1) Schäuble diagnostiziert globale stark vernetzte komplexe Herausforderungen, die einhergehen mit einer Vielfalt, die nach einer Reduktion auf das Wesentliche verlangt, um sinnvolles Verhalten möglich zu machen. Für ihn sind die Parlamente jene Orte, wo die Reduktion auf das Wesentliche stattfinden muss.
(2) Hier ist interessant, dass Schäuble das Prinzip der Repräsentation eindeutig gegen die Forderung nach Repräsentativität abgrenzt. Da sich — aus rein praktischen Gründen — die reale Vielfalt der Bürger nicht 1-zu-1 in einem Parlament abbilden lässt, leitet er daraus ab, dass Repräsentation rein formal interpretiert werden muss: der gewählte Vertreter repräsentiert nicht einzelne, spezielle Gruppen, sondern ‚das ganze Volk‚. Er formuliert dazu „Sie [die Abgeordneten des Bundestages] vertreten die Repräsentierten nicht durch ihre Person, sondern durch ihre Politik.“
(3) Schäuble entgeht allerdings nicht, dass die Politik der Repräsentanten Teile der Repräsentierten nicht mehr überzeugt. Er leitet daraus die Forderung ab, dass mehr Streit in der Mitte der Gesellschaft möglich sein muss, der zudem öffentlich im Parlament ausgetragen werden soll.
(4) Eine Ursache für die Unzufriedenheit der Wähler lokalisiert Schäuble in globalen Problemstellungen, die sich auf nationaler Ebene allein nicht lösen lassen, was indirekt auf einen größeren politischen Kontext verweist, auf Europa, dessen parlamentarische Kontrolle allerdings gestärkt werden müsse.
(5) Für die objektiv messbare Unzufriedenheit der Bürger sieht Schäuble aber nicht das Ungenügen der Parlamente als Ursache, sondern in den massiven Veränderungen in der Gesellchaft selbst. Einen solchen Aspekt der gesellschaftlichen Veränderungen sieht er gegeben in der zurück gehenden Bindungsbereitschaft an bislang vertraute Gruppierungen.
(6) Den Trend, die Unzufriedenheit der Bürger in Form von Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren, zufällig zusammengesetzte Bürgerräte, oder Volksabstimmungen zu kanalisieren, sieht er sehr kritisch, wenig konstruktiv, eher bedrohlich.
(7) Die faktische Erweiterung von Öffentlichkeit durch das Internet, die eine Demokratisierung der Demokratie unterstützen könnte, in der jeder direkt seine Meinung kundtun kann, sieht Schäuble ebenfalls sehr kritisch: es entstehen immer mehr Teilöffentlichkeiten, die eher gegeneinander, statt miteinander funktionieren; die für eine Demokratie unerlässliche gemeinsame Öffentlichkeit zersplittere in immer mehr Fragmente. Steigende Partizipationserwartungen suchen sich immer mehr neue Wege, auch solche, die mit populistischen Mitteln den schnellen Erfolg suchen.
(8) Angesicht dieser starken Tendenzen hält er ein Plädoyer für die parlamentarische Demokratie und für das strukturelle Element der politischen Parteien, die akuten, kurzlebigen populistischen Tendenzen widerstehen können. Sein Leitmotiv drückt sich gut in der Formulierung aus: Die Demokratisierung der Demokratie macht Repräsentation nicht entbehrlich. Angesichts einer wachsenden Vielfalt geht es auch und immer mehr um Ausgleich von widerstreitenden Interessen. Parlamente sind für Schäuble Orte der Gemeinsamkeit und Orte der Verantwortung.
(9) Für Schäuble führen diese beobachtbaren Schwächen und Unzulänglichkeiten der Repräsentation zurück zu den politischen Parteien: diese müssten sich erneuern um den Tendenzen zur Individualisierung und zum Strukturwandel gerecht zu werden. Dies könne nur geschehen, wenn die Bürger mehr als bisher in die konkrete Parteiarbeit eingebunden würden, so dass die verfassungsgemäße Repräsentation funktioniere, aber in mehr lebendigem Kontakt mit den Bürgern. Dies motiviert Schäuble zu der Feststellung: „Der Weg, gesellschaftliche Vielfalt im Parlament sichtbar zu machen, führt nicht über das Wahlrecht, sondern über die Parteien.“ In den Parteien selbst brauche es Vielfalt, brauche es Toleranz, brauche es Kompromissfähigkeit; das erhöht die Attraktivität von Parteien.
(10) Nach all diesen Überlegungen hält Schäuble fest, dass „die wichtigste Aufgabe“ von politischen Parteien letztlich ist, solche Politiker*innen hervor zu bringen, die in den Parlamenten ihrer Gesamtverantwortung gerecht werden können.
GEDANKEN ZUM ARTIKEL
Auf den ersten Blick kann man diesen Artikel von Schäuble als ein engagiertes Plädoyer für die Idee eines repräsentativen Parlamentes lesen, das getragen wird, von politischen Parteien, die im Wirrwar des Alltags eine besonnene, Extreme ausgleichende Politik möglich machen, die ‚dem Volke‘ dient.
Dass es eine zunehmende Unzufriedenheit der Bürger (der ‚Repräsentierten‘) mit ihren gewählten politischen Repräsentanten gibt, nimmt Schäuble wahr; auch, dass sich der Wille zu mehr Partizipation in immer mehr Initiativen manifestiert, die an den politischen Parteien vorbei um Gehörtwerden ringen. Die vielen — z.T. ja verfassungskonformen — Partizipationsformate außerhalb der verfassten politischen Parteien werden aber von Schäuble kritisiert; in ihrer inhärenten Partikularität könnten sie den jeweiligen Gesamtzusammenhängen nicht gerecht werden. Sie seien kein Ersatz für politische Parteien und das Parlament des Bundes (die Landes, Kreis und Ortsparlamente werden von ihm nicht eigens thematisiert).
Bei den möglichen Ursachen für die Unzufriedenheit der Bürger bleibt Schäuble sparsam mit seinen Gedanken. Strukturell sieht er — sehr abstrakt — stark vernetzte global initiierte Veränderungsprozesse, die auf Deutschland und den Alltag der Bürger einwirken, die sich nur partiell rein national gestalten lassen. Das Internet sei primär ein Medium der Zersplitterung von Öffentlichkeit. Die stattfindenden gesellschaftlichen Veränderungen führten zu einer abnehmenden Bindungswilligkeit der Bürger, so dass sie sich weniger als früher den politischen Parteien anschließen wollten. Es fehlt nicht viel, die Position Schäubles so zu lesen, als ob für ihn der unzufriedene Bürger die Rolle eines ‚Schuldigen‘ einnimmt, der den Weg der Tugend, den Weg der verfassungsgemäßen politischen Parteien, aus eigenem Unvermögen nicht mehr wahrnimmt, und damit zu einer Gefahr für das System ‚repräsentatives Parlament‘ wird.
Sein entschiedenes Pläydoyer für die zentrale Rolle politischer Parteien und für das repräsentative Parlament auf der Basis der politischen Parteien liest sich auf den ersten Blick sehr ’staatmännisch‘. Auf den zweiten Blick — und vieler weiterer Blicke — ist der Weg zu einer schrillen Disharmonie nicht weit.
Wie die zahllosen Enthüllungen von — zum Glück noch vorhandenen — kritischen Journalisten und Journalistennetzwerke der letzten Jahre gezeigt haben, ist eine — vielleicht die stärkste — Ursache für die wachsende Unzufriedenheit der Bürger mit dem Parlament (und nicht nur auf Bundesebene!) nicht das mangelnde Engagement der Bürger sondern das Parlament selbst! Dass Deutschland international als Eldorado für Lobbyismus gilt; für Geldwäsche; für vielfältige Formen organisierter Kriminalität; für ein willfähriges Werkzeug der Finanzindustrie, die jährlich mit mehrstelligen Milliardenbeträgen der Steuerzahler jonglieren; für den Ausverkauf von Immobilien und Agrarflächen sorgen; für mangelnde Qualitätskontrollen in wichtigen Lebensbereichen der Bürger; für einen unübersehbaren Verfall wichtiger Infrastrukturen; für ein immer schlechter werdendes Bildungssystem, was unsere nationale Zukunft unmittelbar bedroht … und vieles mehr …, das wurzelt nicht im fehlenden Engagement der Bürger, sondern im Verhalten von Parlamentariern, die Gesetze verabschieden, die all dies mindestens zulassen, wenn nicht gar befördern oder sogar erzwingen, zumindest aber zum Missbrauch einladen. Wenn die Parlamentarier zugleich in parlamentsfremden Gremien, Institutionen, Verbänden oder Firmen sitzen, deren Interessen sie direkt in die wichtigen Ausschüsse und Gesetzesverabschiedungen hineintragen, dann ist der Bürger systemisch neutralisiert. Dies erzeugt beim aufgeklärten Bürger ein tiefgreifendes Ohnmachtsgefühl, Enttäuschung, Politikverdruss, und — hoffentlich eigentlich — eine Form von Agressivität, die dann zu einem Handeln drängt: Das darf doch gar nicht wahr sein; im Parlament verschaffen sich — ganz offensichtlich ermöglicht durch die Mehrheit der Abgeordneten — unverhohlen bürgerfremde Interessen von außen einen direkten Zugang, um sich selbst an der Öffentlichkeit vorbei ‚ganz legal‘ zu bedienen. Der Übergang vom Lobbyismus zu unverhohlenen neuen Formen ’struktureller Korruption‘ erscheint hier fließend.
Vor diesem Hintergrund erscheint das Zeigen von Schäuble auf den bindungsunwilligen Bürger, der wie ein ungezogenes Kind den ‚ordentlichen Weg‘ der politischen Parteien nicht richtig wahrnimmt, fast wie blanker Hohn. Als Präsident des Bundestages weiß Schäuble eigentlich ziemlich genau, welche Einflussnahmen auf das Parlament durch die Parlamentarier in ihren ‚multifunktionalen Interessensrollen‘ stattfinden — und wenn er es nicht wüßte, wäre er ein sehr schlechter Präsident des Bundestages — , und dass er diese vielfach bekannt gemachten Sachverhalte nicht einmal erwähnt, mit keinem einzigen Wort, erzeugt ein großes Befremden und damit eine Verstörung, eine Verunsicherung, ein mögliches Mißtrauen, ein Mangel an Glaubwürdigkeit. Die Bürger anzuklagen, ohne den leisesten Hauch von parlamentarischer Selbstkritik, das ist die schlimmste Sünde, die ein Parlamentarier begehen kann.
Natürlich ist es so, dass wir in real stattfindenden gesellschaftlichen Umbrüchen leben, die letztlich jeden Bereich der Gesellschaft betreffen, jeden Bürger (am wenigsten allerdings die ‚Reichen‘, die ‚ihre Vertreter‘ direkt im Parlament sitzen haben), nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern unseres Heimat-Planeten Erde. Natürlich ist es so, dass wir diese Probleme nicht mehr einzeln, nicht mehr nur lokal lösen können; wir sind zu einem großen kooperativen Zusammenwirken herausgefordert, wollen wir nachhaltige Lösungen finden. Ganz neu ist dies nicht, aber heute ist es unabwendbar real geworden, wo sogar die Zeit erlebbar real zählt. Natürlich ist es so, dass lebendige politische Parteien, die mit dem Bürger leben, diskutieren und handeln, eine wundervolle Hilfe sein könnten, um alle zusammen in einer repräsentativen Demokratie ein Optimum an Lösungen zu ermöglichen. Dazu aber braucht es Formen von Kommunikation und Formen von Wissen, die weit über das hinaus gehen, was wir zur Zeit in Deutschland alltäglich praktizieren. Und vor allem braucht es dazu ein transparenter bürgernahes Parlament, das das Vertrauen der Bürger wahrhaft verdient.
Schäubles Gedanken sind weit entfernt von dieser zukunftsfähigen, nachhaltigen Realität. Sein Artikel ist eher geeignet das Ohnmachtsgefühl der Bürger in diesem Land weiter zu vertiefen.
Was kann man in solch einer Situation als Bürger noch tun, wenn man überzeugter Demokrat sein will? Nur wählen zu gehen reicht bei einem solchen Parlament nicht. Es ist schon längst ganz woanders, nicht beim Bürger und nicht bei den wahren Problemen dieses Landes.