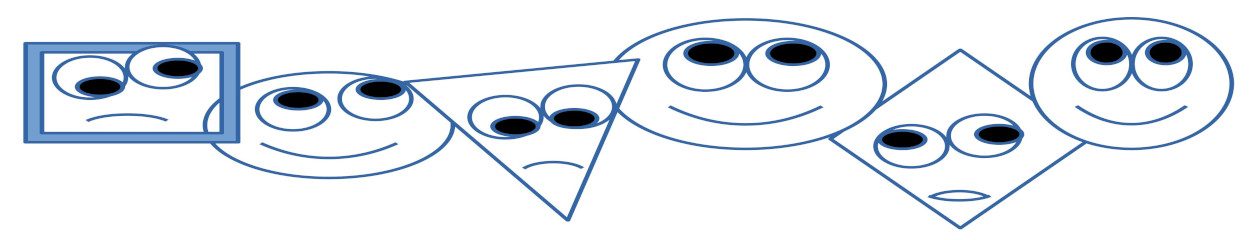(Letzte Änderung: 16.September 2023)
Die Dynamik der Prozesse ist momentan noch zu groß, als dass die Idee eines Buches in Reichweite liegt. Allerdings gibt es zur Zeit folgende ‚Themenkerne‘, aus denen heraus sich jeweils ein Buch entwickeln könnte:
- Die Gedanken in dem Post „HOMO SAPIENS: EMPIRICAL AND SUSTAINED-EMPIRICAL THEORIES, EMOTIONS, AND MACHINES. A SKETCH“ [1] werden in einer erweiterten Form in einem Buch von de Gruyter erscheinen (ca. Frühjar 2024). Dieser Text bietet sich als Grundkonzept an für einige grundlegenden Themen in Form eines Buches (dann Deutsch und Englisch).
- Auf der kommenden Seite https://sw-de.oksimo.org/ (https://sw-en.oksimo.org/) werden ab Oktober 2023 kontinuierlich Erläuterungen und Beispiele zur oksimo-Software wie auch zur oksimo-Theorie veröffentlicht werden. Dieses Material bietet sich an als Ausgangspunkt für ein Buch zur oksimo-Theorie und oksimo-Software.
- Zur Zeit bereitet eine Arbeitsgruppe der Frankfurt University of Applied Sciences (FUAS) einen neuen Ansatz im Bereich Weiterbildung für kommunale Verwaltungen vor. Kern des Ansatzes ist eine Unterstützung der Verwaltung zum Aufbau einer Zukunftsplanung die weit über das bisherige Konzept einer Smart City hinausgeht.
ANMERKUNGEN
[1] https://www.uffmm.org/2023/08/24/homo-sapiens-empirical-and-sustained-empirical-theories-emotions-and-machines-a-sketch/